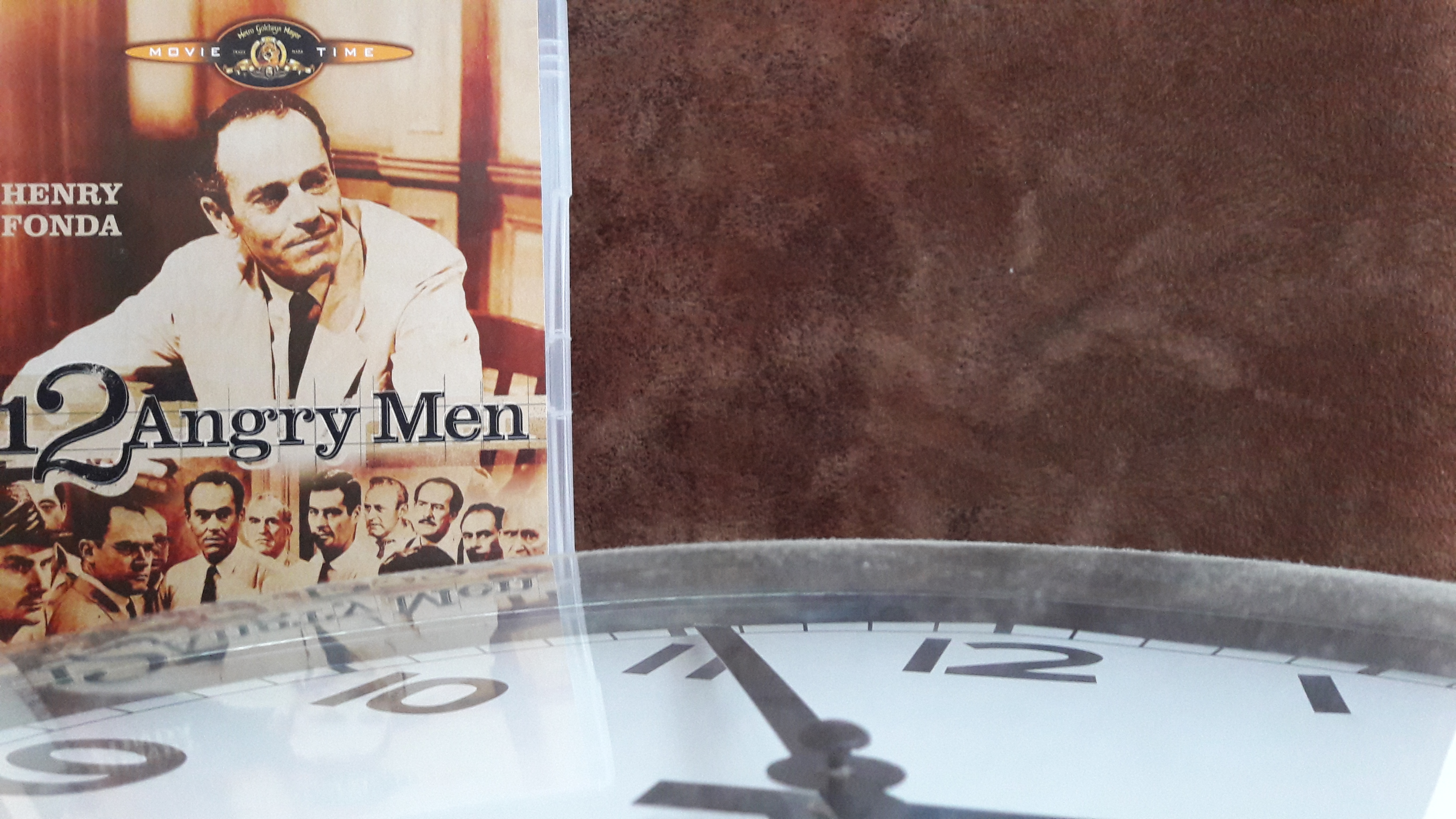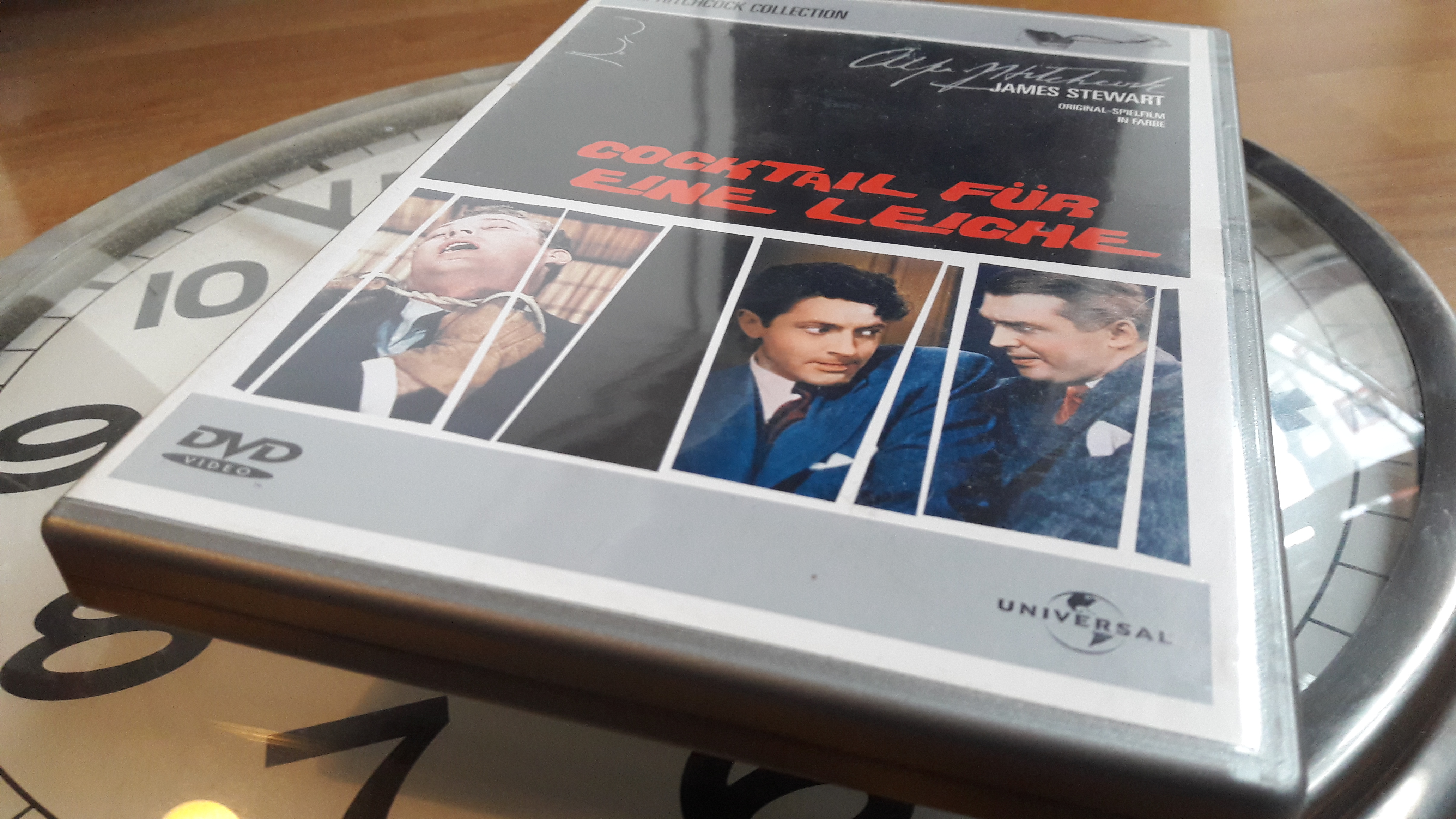Sidney Lumet ist mit New York so verheiratet wie sonst nur Woody Allen. Und ebenso manisch-produktiv. Beinahe sein ganzes filmisches Leben hat er im „Big Apple“ zugebracht. Seine eindrucksvolle Karriere begann 1957 mit einem Knall. „12 Angry Men“, Lumets erste Spielfilmregie nach einigen Broadway-Engagements und einer ganzen Reihe von TV-Produktionen, auch mit dem jungen Walter Cronkite, öffnete dem damals Anfang-Dreißigjährigen mittelfristig in Hollywood Türen und Tore. 2011 ist er 86-jährig gestorben. In New York, versteht sich. Das Œuvre, an dem er fünfzig Jahre lang unermüdlich geackert und gefeilt hat, umfasst knapp vierzig Filme – von denen keiner so recht leugnen kann, ein „echter Lumet“ zu sein.
Das ist ein Regie-Debüt?
„12 Angry Men“ ist mit enormer ästhetischer Souveränität und handwerklicher Präzision ausgeführt, wie es für einen Kino-Erstling höchst ungewöhnlich ist. Ja, Lumet hatte seine Erfahrung. Und auch der verdiente Kameramann Boris Kaufman, seinerzeit schon ein alter und oscarprämierter Hase, hatte sein Zutun an dem dezidierten und vollendeten Look dieses Streifens. Aber ohne Standing und Vision bringt man so was nicht fertig. Es ist Lumets Unerschrockenheit, vielleicht Naivität zu verdanken, dass er es mit der motivischen Nüchternheit eines Gerichtsstoffes aufnimmt, damit auch noch debütiert.
Die Geschichte findet fast ausschließlich im Geschworenenzimmer eines Gerichtes statt. Dort kommen zwölf Herren zusammen, Mitglieder einer Jury, die über das Schicksal eines Angeklagten zu entscheiden zu haben. Dem Angeklagten, einem vom Leben gebeutelten 18-jährigen Puerto-Ricaner aus den Slums, wird zur Last gelegt, seinen Vater ermordet zu haben. Finden die Geschworenen ihn schuldig, sühnt er mit seinem Leben. Andernfalls kommt er frei. Guilty or not guilty? Nach der ersten Abstimmung steht es 11:1 gegen den Jungen. Es folgen hitzige Auseinandersetzungen. Am Ende steht der Freispruch.
Die Handlung ist packend, die Inszenierung klug bemessen. Da ist zum Beispiel das Außen, das Wetter, ein Hochsommer in der Großstadt, stickig und schwül. Die Hochhausschluchten, die, getrennt von den unter der schweren Hitze keuchenden Straßen, drohen, zu einem dampfenden Klump zu verschmelzen. Die Welt wartet und bangt und harrt: Ein Geruch in der Luft kündigt einen erlösenden Schauer an. Aber wann?
Man schwitzt mit
Obwohl nichts davon je so im Detail im Film gezeigt oder sonst filmisch ausbuchstabiert wird – man fühlt es. So dicht ist die Atmosphäre, so eng ist sie mit der Narration verwoben. Wie die Last der Verantwortung, die der Jury obliegt, drückt die Bullenhitze auch, macht die nötige Konzentration zu einem Drahtseilakt, erhitzt die empfindlichen Gemüter der zwölf Männer.
Die Kamera führt uns indessen gekonnt an der Nase herum. Die Halbtotalen und High-Angle-Shots, die zu Beginn des Films das Zimmer, in dem sich alles abspielt, oft ganz, immer hell und übersichtlich zeigen, lassen noch Raum zum Atmen und Denken. Während sich die Handlung zuspitzt, verjüngen sich die Perspektiven, Details reihen sich an Details, harte Gegenschnitte geben zunehmend weniger Orientierung. Der Raum wird kleiner – scheint es –, die anfängliche Einigkeit der Geschworenen brüchig, Grüppchen bilden sich, Gesinnungen rücken enger zusammen.

„12 Angry Men“ kommt fast ohne Ellipsen aus, die Szenen sind brillant ohne nennenswerte oder auffällige Aussparungen montiert. Die so erzeugte Illusion der Zeitdeckung, als wäre gefilmte gleich erzählter Zeit, fordert den Zuschauer gewaltig. Der Film zehrt. Daher die Erschöpfung beim Abspann. Es fühlt sich an, als hätten wir tatsächlich selbst den Nachmittag als ein Geschworener bei zermürbenden Debatten in diesem Zimmer verbracht. Der Plot provoziert die aktive Teilnahme des Zuschauers, der Schnitt unterstreicht das.
Der hervorragend Cast tut dann das Übrige – allen voran Henry Fonda und Lee J. Cobb. Fast choeografiert wirken die sorgfältig in sämtlicher Mimik und Bewegung durchdachten Szenen. Die Charakterzeichnung ist so nuanciert und fein abgesteckt; wäre Dialektik das Ballett, „Die Zwölf Geschworenen“ wäre Schwanensee und Lumet der Leiter des Bolschoi. Es explodiert ja nichts in diesem Film, es gibt auch keine Verfolgungsjagden. Aber man traut sich vor Spannung nicht, nur einmal wegzusehen. Grund dafür: Die persönlichen Konflikte der Geschworenen, das Ringen um die Oberhand im Diskurs, ein Tanz um Macht. Was ganz nebenbei auch das das US-amerikanische Rechtssystem ad absurdum führt. Man ist so nah bei den Figuren, jeder findet sich wieder in den archetypisch angelegten Widerstreiter.
Der Schauspieler Ossie Davis erzählt in einer aufschlussreichen Dokumentation über das Leben und Schaffen Lumets folgende Anekdote: Beim Dreh zu dem 1965 entstandenen FIlm „The Hill“ (dt. Ein Haufen toller Hunde), hatte sich Davis einen Zeh gebrochen und wusste nicht recht, wie in aller Welt und ob er die nächste Szene, wohl eine laufintensive Arbeit, abdrehen könnte. Eigentlich undenkbar bei den Schmerzen, berichtet Davis. Lumet habe dann sinngemäß zu ihm gesagt: „Warum versuchst du nicht, die Schmerzen aus dem Zeh in die Szene zu übertragen?“ Lumet holt, das gilt für jeden seiner Filme, das äußerst mögliche aus den Spielern raus, so auch in „12 Angry Men“, und das zieht gleichsam in den Film rein – unentrinnbar, wie ein Sog.
„Few filmmakers have been so consistently respectful of the audience’s intelligence“, hat der Roger Ebert, der Reich-Ranicki der Filmkritik, über Sidney Lumet geschrieben. Wie recht er hat.
Felix‘ 3 Picks
Auf unserem Blog ging es diesmal um „Filme in Real Time“, bei denen es so scheint, als wären Filmzeit und Erzählzeit identisch. Zuweilen ist das sogar wirklich so. Man spricht dann von „Zeitdeckung“. Felix hat hierfür Hitchcocks „Ein Cocktail für eine Leiche“ ausgewählt. Sandra hat darüber geschrieben.
Ansonsten empfiehlt Felix dazu wärmstens:
- High Noon (Fred Zinnemann, 1952)
Letterboxd | IMDb - My Dinner with André (Louis Malle, 1981)
Letterboxd | IMDb - Lola rennt (Tom Tykwer, 1998)
Letterboxd | IMDb