„Drum paart, zu eurem schönsten Glück,
Mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick“
– Schiller
Seit der Veröffentlichung 1843 dieser unterdessen Mutter aller Weihnachtsstoffe, wurde die Geschichte von Ebenezer Scrooge dutzende Male verfilmt, vertont und auf die Bühne gebracht. Zeitgenössische Rezipienten haben in der Erzählung eine Parabel auf Marx‘ Arbeitswerttheorie oder eine sentimentale Krawallschrift Dickens‘ gegen den homo oeconomicus gelesen. Auch zum Gleichnis über Leiden, Tod und Auferstehung im messianischen Sinn wurde „A Christmas Carol“ gekürt. Der französische Literaturkritiker hat der Erzählung eine ganze „Philosophie de Noël“ gewidmet.
„Marley was dead: to begin with.“ So fängt sie an, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und tatsächlich ist Dickens‘ Erzählung wesentlich eine Erzählung von Dos and Don’ts, nicht bloß zu Weihnachten, sondern im Leben überhaupt, eine Liebesethik durch Selbsterkenntnis gewissermaßen. Es geht um Leben und Tod und um nichts Geringeres. Scrooges Problem ist dabei nicht etwa die Grinch’sche Unpässlichkeit, die ja auch tief psychologisch verwurzelt ist. Es ist auch kein Entfremdungs-Blues, kein „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ – in diesem Leiden ist immerhin schon die Arznei – Selbsterkenntnis! – symptomatisch angelegt.
They sin by Liflessness
Eine gute Diagnose gab der Poet Laureate der US-amerikanischen Beat- und Road-Literatur, Jack Kerouac, als er die schöne Zeile „They sin by lieflessness“ dichtete. Scrooge ist blutleer, kalt, engherzig, schmallippig und gefühlsroh – und das mit Vorsatz und vor allem zu Weihnachten.
Wenn an jeder Ecke liebestolle Festtags-Spinner lauern, um einander mit Geschenken und Umarmungen zu ersticken. Wenn wildfremdes Gesindel, was völlig zurecht den Bodensatz der Gesellschaft ausmacht, mit feuchten Augen und hohlen Wangen die kleinen, arbeitsscheuen Patscherchen nach Almosen ausstreckt. Wenn ausgerechnet der ärmste Lump meint, sich eine Gans leisten zu müssen, spätestens dann ist es Zeit für Scrooge, die Zähne noch etwas fester zusammenzubeißen, die gleichgültigen Augen hinter zu Schlitzen verjüngten Lidern verschwinden zu lassen und, nicht zu vergessen, die mickrige Flamme im Heizofen bis an die Grenze ihrer schmählichen Existenz zu drosseln.
Oh, Captain!
Was da in Scrooges Stube in einem Stövchen züngelt, ist wahrlich nicht die Flamme der Erkenntnis. Um dieses Licht neu zu entzünden hetzt ihm sein ehemaliger, lang verstorbener Kompagnon drei Geister auf den Hals, die ihn mittels bestürzender Visionen auf den rechten Pfad zurückweisen.
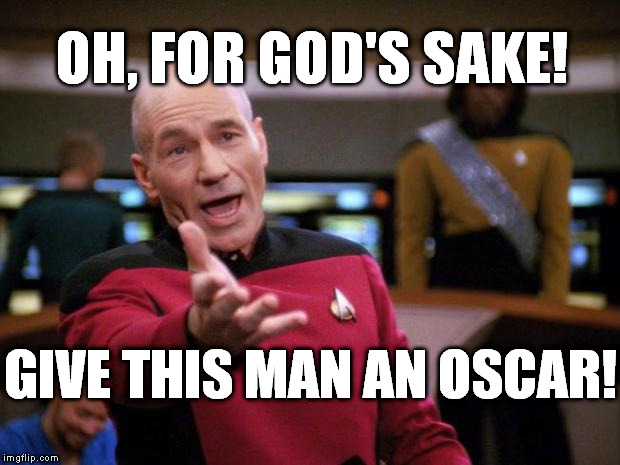 Die 1999er Verfilmung leistet mit nahezu maximaler Werktreue einen unverstellten Einblick in Scrooges Welt. Was die Adaption von David Hugh Jones indessen aber so ungeheuer sehenswert macht, ist – neben den peinlichen special effects – Sir Patrick Stewart. Charles Dickens könnte ja auch Einkaufszettel oder Bedienungsanleitungen schreiben. Sein Werk lebt wesentlich von seiner mächtigen Sprache, einem Englisch, das qua Schönheit und Vollendung seinesgleichen sucht. Und wer könnte das besser als Captain Picard höchstselbst. Viele haben es versucht, Alastair Sim und George C. Scott gehören zu den besten, aber Stewart hat als Scrooge die Nase klar vorn. Sein Spiel ist perfekt.
Die 1999er Verfilmung leistet mit nahezu maximaler Werktreue einen unverstellten Einblick in Scrooges Welt. Was die Adaption von David Hugh Jones indessen aber so ungeheuer sehenswert macht, ist – neben den peinlichen special effects – Sir Patrick Stewart. Charles Dickens könnte ja auch Einkaufszettel oder Bedienungsanleitungen schreiben. Sein Werk lebt wesentlich von seiner mächtigen Sprache, einem Englisch, das qua Schönheit und Vollendung seinesgleichen sucht. Und wer könnte das besser als Captain Picard höchstselbst. Viele haben es versucht, Alastair Sim und George C. Scott gehören zu den besten, aber Stewart hat als Scrooge die Nase klar vorn. Sein Spiel ist perfekt.
Die Spezialeffekte, ich will nicht zu sehr drauf rumreiten, irritieren vor allem, weil der Film ansonsten so um Nüchternheit bemüht ist. Und es war ja immerhin das Jahr vorm Millennium. Und nicht mehr zu Thomas Edisons Zeit, als der Film entstand. Die Nebendarsteller machen ihrem Namen indessen alle Ehre, sind eher Beiwerk und kommen Stewarts Spiel so nicht in die Quere.
In der Erinnerung bleibt der Film als Soliloquy Patrick Stewarts. Und das ist gut so!
Felix‘ 3 Picks
Und weil Dickens, wie alles, doppelt besser hält, hat Felix für den zweiten Teil des Cineventure Weihnachts-Specials „Scrooged“ ausgesucht, Sandra bloggt darüber.
Ansonsten empfiehlt Felix zum Fest:
- White Christmas (Michael Curtiz, 1954)
Letterboxd-Link - Holiday Inn (Mark Sandrich, 1942)
Letterboxd-Link - Miracle on 34th Street (George Seaton, 1947)
Letterboxd-Link





