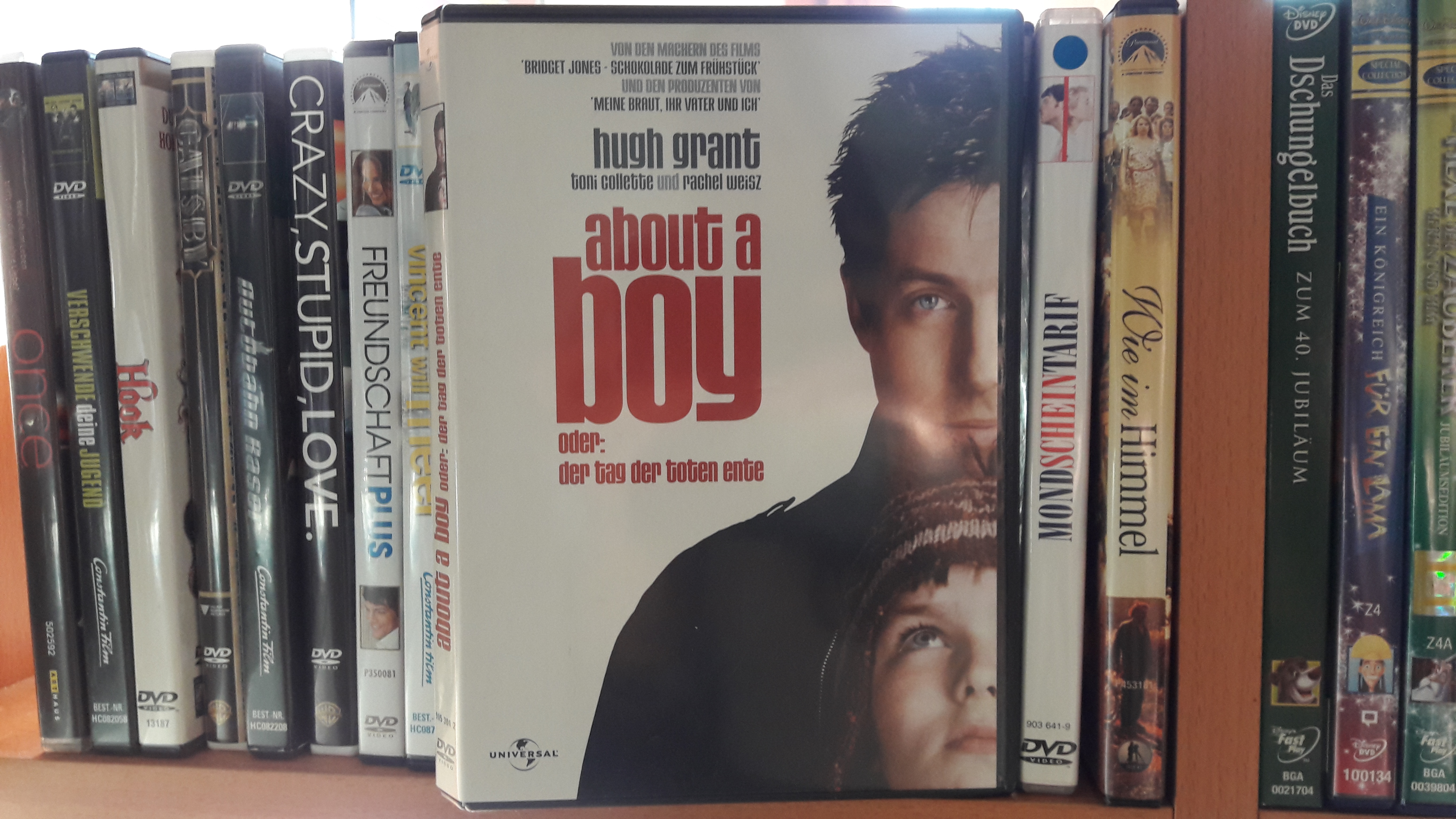Regie-Routinier Lasse Hallström bleibt sich treu. Sein 2014er Film „The Hundred-Foot Journey“ lockt mit Fusion-Food. Letztlich ist es auch nur ein Fertiggericht und ein kitschiges obendrein. Was nicht heißen soll, dass der Film, der als „Madame Mallory und der Duft von Curry“ in den Deutschen Kinos zu sehen war, misslungen ist.
Der Plot in einem Satz: Nachdem politische Unruhen in Mumbai die Gastronomie-Familie Kadam (brillant angeführt von Om Puri als Papa) zur Flucht gezwungen haben, finden sie nach einigen Mühen in einem malerischen Dörfchen in Frankreich ein neues Zuhause, wo sie kurzerhand auch ein neues Restaurant eröffnen.
Schmeckt wie Hühnchen
Das leicht verkochte Culture-Clash-Drama arbeitet ein striktes, aber auch schales Erfolgsrezept ab: Familie Kadam steht für das Fremde, dass das ungetrübte Einerlei in Saint-Antonin stört. Stein des Anstoßes, Quell des Konflikts und roter Faden der Handlung ist der Unmut und die Karrieresucht von Madame Mallory, gespielt von Helen Mirren. Sie betreibt bereits ein Restaurant in der Kleinstadt. Und nicht etwa irgendeins: Das „Le Saule Pleureur“ trägt voller Stolz einen Michelin-Stern, sogar der Präsident kommt regelmäßig zum Essen. Und nicht etwa irgendwo: Das Restaurant der resoluten Mallory liegt auch noch genau gegenüber jenem Etablissement, das die Kadams als „Maison Mumbai“ neueröffnen. Fortan steht Chicken Masala gegen Froschschenkel und Naan gegen Baguette.
Die Geschichte wird aus der Sicht von Kadam Junior erzählt: Hassan Kadam, ein schüchterner Eyecatcher, hat in Mumbai seine Mutter verloren, die ihm die Magie des Schmeckens offenbart und ihn die Koch-Kunst gelehrt hat. In Frankreich verguckt er sich in Marguerite. Doch die Liebe darf nicht sein: Die Schöne kocht für Madame Mallory. Binnen der ersten fünfzehn Minuten wird glasklar, wie der Film seinen Lauf nehmen wird. Es passiert nichts, aber auch gar nichts, was nicht meilenweit vorhersehbar gewesen wäre. Während Madame Mallory natürlich doch über ihren Schatten springt und Gemeinsames im vermeintlich Fremden findet, hat der Zuschauer nichts Neues zu befürchten: Hier schmeckt alles wie Hühnchen.
Wie schlimm ist Vorhersehbarkeit?
Madame Malory opfert mindestens zwei gute Scharnierstellen im Plot. Das ist zum einen der Verlust der Mutter und zum anderen die Fremdenfeindlichkeit in Europa.
Um ein Wohlfühlfilm zu bleiben hetzt uns der Regisseur durch einen Anschlag in einer indischen Metropole, Feuer, Geschrei, Mutter tot. Wie aus einem bösen Traum erwacht der Zuschauer zusammen mit Familie Kadam in Europa, kurz durchatmen, jetzt kann alles gut werden.
Der Aspekt des Rassismus kommt auf noch bedenklichere Weise zu kurz: Er gipfelt in einer Brandstiftung durch den Chefkoch vom „Le Saule Pleureur“. An diesem Punkt beginnt Madame Mallorys eigene Katharsis. Sie erkennt, dass ihr der kulinarische Kleinkrieg aus der Hand gerät. Reumütig schrubbt sie die vandalisierte Mauer vor dem „Maison Mumbai“, die mit einem Schriftzug à la „Esst nicht beim Inder“ verschändelt wurde. Es regnet in dieser Szene ausnahmsweise mal, Papa Kadam hält ihr den Schirm. (Neben Sonnenschein und dem vereinzelten Schauer kennt das Wetter in dem Film vor allem den Modus „Feuerwerk“.) Der Rest ist drollig, kuschelig und versöhnlich.
Der Film spart nicht mit Zuckerguss, damit alles es besser schmeckt und flott satt macht und eben, um den Erwartungshorizont der Zuschauer nicht zu weit zu stecken.
Von Bananenschalen
Die Struktur eines Filmtextes entsteht in der Interaktion, quasi der Aneignung desselben durch den Zuschauer. Und Vorhersehbarkeit meint alle Elemente, die qua Textgattung strukturell vorgegeben sind und eingehalten werden. Die Semiotik untersucht Zeichen aller Art in ihrem Kontext und fragt: Was kann ein Zeichen alles sein? Der semiotische Gehalt der Bananenschale ist innerhalb des Slapstick-Genres besiegelt. Auf ihr wird ausgerutscht. Das unterliegt Regeln einer vorsprachlichen und impliziten Vereinbarung. Der Zufall ist hier, wie auch sonst wo, der beste Freund der Notwendigkeit und je dichter das Netz solcher etablierten Zeichen und filmischen Codes, desto vorhersehbarer das Ergebnis.
Freilich käme niemand je auf die Idee, bei der Hälfte von „Titanic“ entnervt zu stöhnen: „Dass der Kahn sinkt, war so klar!“ Zugegeben, dem Regisseur ist bei der Bearbeitung eines in erster Linie geschichtlichen Stoffes bei solchen Schlüsselelementen im Plot nicht viel Freiraum gegeben. Aber auch das kann Einer auch besser oder schlechter machen. Ganz rigoros könnte man so auch behaupten, dass es tatsächlich nur eine Handvoll origineller Western gibt und es sich bei dem immensen Rest bloß um eine hundertfache Collage, Variante und Umdichtung handelt. So ist es aber nicht, denn entscheidend ist einzig und allein die Ausführung und die Filmgeschichte ist reich an Beispielen, die zeigen, dass sich der Mut einiger weniger Outlaws auszahlt, die mit Konventionen brechen.
Der Film ist aber nun mal nicht nur Kunstform, sondern auch (und fast ausschließlich zuerst) Ware und als solche den einfachsten Gesetzen des Marktes unterworfen. Wenn man nicht will, dass ein Produkt floppt, dann schneidert man es nicht auf ein Zielgrüppchen zu, sondern achtet darauf, dass es Massen kleidet. Zumal, um zu Madame Mallory zurückzufinden, wenn man eine Botschaft hat, die sich besser jeder Erdenbürger hinter die Löffel schreiben sollte, nämlich Xenophobie ist scheiße, dann könnte es sogar wichtig und richtig sein, inhaltliche Doppeldeutigkeiten und kunstvolle Schnörkel zu vermeiden und alles auszubuchstabieren, damit es auch der Letzte rafft.
Wie schlimm ist also jetzt Vorhersehbarkeit bei Filmen? Eigentlich gar nicht. Die Bedingung ist, dass er gut verpackt ist. Und Lasse Hallströms „The Hundred-Foot Journey“ ist sehr, sehr hübsch verpackt. Mein ganz persönlicher Anspruch heißt aber eindeutig: Mehr Mut! Weniger Weichzeichner! Denn Hallström verschießt jede Menge Pulver beim Umschiffen von „guten“, tauglichen politischen Konflikten und bringt sein Publikum so um den heimlichen Herzmuskel seines Dramas. Man muss sich ja nur fragen: Was wäre „Madame Mallory“ nach Abzug aller indischen Handlungselemente? Ein guter Wohlfühlfilm.
Zum Nachtisch ein Kompliment
Ein Kompliment blieb bislang ausgespart: Madame Mallory lebt zu großen Teilen von dem exquisiten Widerspiel zwischen Helen Mirren und Om Puri. Diese beiden hervorragenden Schauspieler sind diesem Film die bitter nötigen Wurzeln und Würze und ihre darstellerischen Fertigkeiten tragen das hartnäckig-liebenswerte und höchst unterhaltsame Gezanke dieser zwei Dickköpfe mit Links.
Felix‘ 3 Picks
Zu dem Thema Essen hat Felix den Film“Babettes Fest“ ausgesucht. Sandra hat ihn gekostet und darüber gebloggt.
Welche Food-Filme Felix außerdem mag:
- Le Charme discret de la Bourgeoisie (Luis Buñuel, 1972)
Letterboxd-Link - La Grande Bouffe (Marco Ferreri, 1973)
Letterboxd-Link - The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover (Peter Greenaway, 1989)
Letterboxd-Link